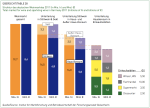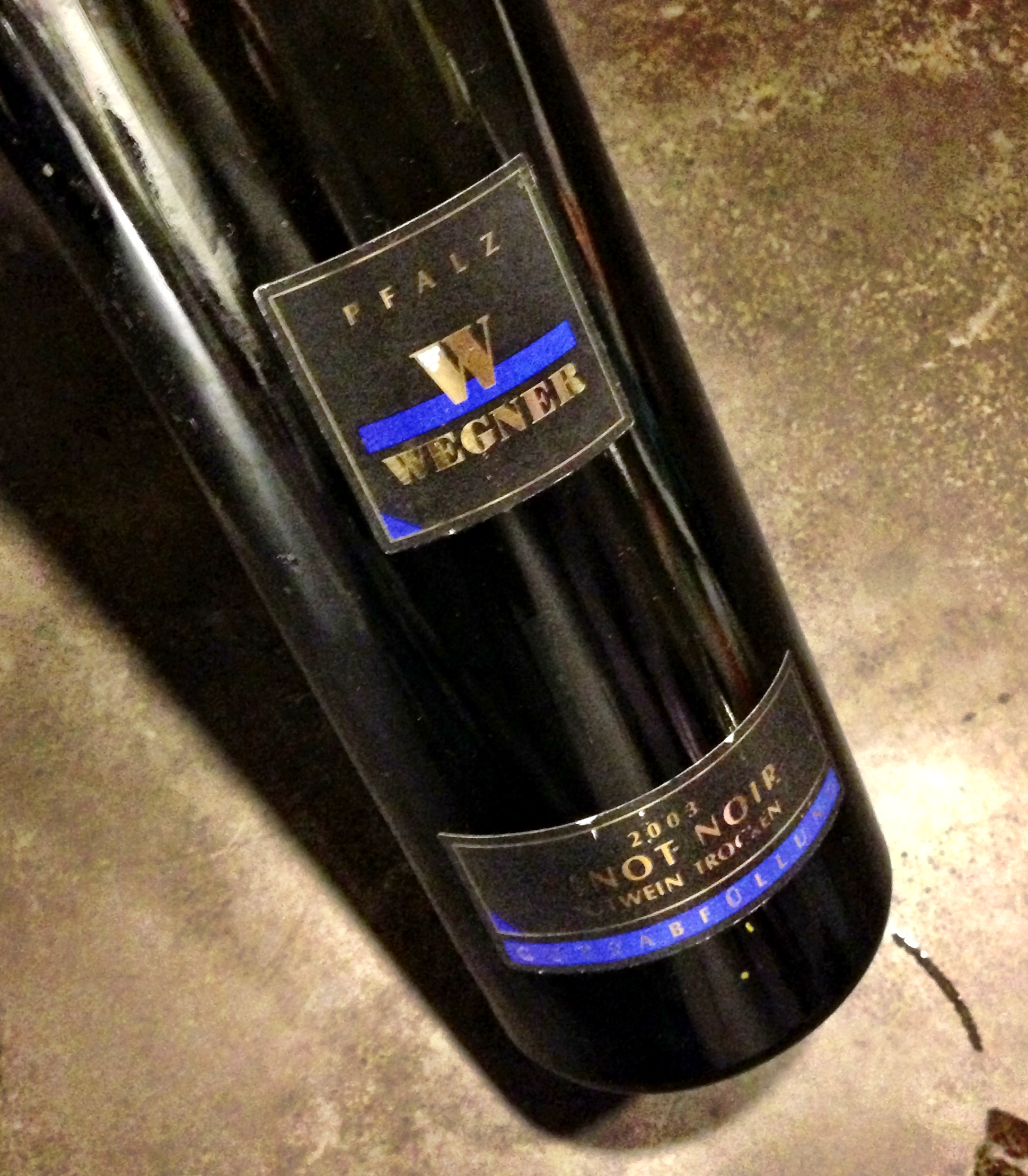Es gibt wenige Aspekte des Weingenusses, die ich so albern finde wie Korken – Diskussionen über Korken vielleicht. Im Zeitalter von Facebook werde ich regelmäßig Zeuge dieser Diskussion – merke: Einzahl, denn es ist immer die gleiche Diskussion. Ausgelöst wird sie zumeist durch die Statusmeldung eines verhinderten Genießers, der beklagt, dass sein gerade geöffneter edler Tropfen korkend als stinkende Brühe aus der Flasche läuft – Echtzeitjammern sozusagen – verbunden mit dem Ausruf: ,Dreckskork‘ (hier sind begrenzt Variationen möglich).
Im nächsten Schritt melden sich ein bis drei Unterstützer, die beifällig murmeln auch sie fänden es absurd, dass man ein Stück Baumrinde für die Genussmittelverwahrung verwende – in der Deluxe-Edition verbunden mit einem Hinweis auf die umweltfrevelhaften Dünge-, Pflanzenschutz- und Bleichmethoden der südeuropäischen Produzenten.
Mit der Präzision einer Sinuskurve folgt als nächstes die Gegenbewegung in Form eines Kommentars von einem Weinfreund, der bemerkt, er sei ja auch ein großer Fan des Schraubers, allerdings nur für die Basis bitte, denn Spitzenweine benötigten schließlich den Sauerstoff zum reifen. Wie orbi auf urbi folgt darauf ein Hinweis, ein guter Korken sei absolut gasdicht, wie ,die Wissenschaft‘ hinlänglich belegt habe. Der ungebildete Gasdurchlasser trollt sich und macht Platz für einen kleinen Einwurf zu Glasverschlüssen, der mit dem Hinweis beiseite gewischt wird, dieser sei längst tot weil nicht in die USA exportierbar (,Ich sag nur: Produkthaftung! Ein Glassplitter in der Flasche und die Millionenklagen fliegen dem Produzenten nur so um die Ohren‘).
Auftritt der Plopper: Nun möchte jemand über die Romantik, das Ritual und sonstige positive Aspekte des ,Plopp‘ sprechen. Selbstredend ist dies nicht dem Vortragenden selbst wichtig, sondern dem ,Durchschnittskonsumenten‘. Er wird brutal umgegrätscht von einem Weinkellner in Ausbildung, der erklärt, ein guter Sommelier wisse das ,Plopp‘ zu vermeiden und in der gehobenen Gastronomie werde die Flasche eh nicht am Tisch geöffnet (was zugegeben am Thema vorbei geht, weil kaum jemand sich noch gehobene Gastronomie leisten kann).
Früher lief die Diskussion ab diesem Punkt langsam ins Leere, doch seit sich auf Facebook Konsumenten mit Produzenten verbrüdern, gewinnt die Diskussion an Komplexität: Auftritt eines Winzers, der ein Foaf-Tale zum besten gibt. Das ist eine Geschichte, die dem Freund eines Freundes passiert ist (friend of a friend, in der Forschung über ,urban legends‘ eben mit foaf abgekürzt, in meiner Generation auch als Spinne in der Yucca-Palme bekannt): Der Schrauber, falsch justierte Maschine, alles undicht, 60% Verlust, Riesenschaden, oje oje. Sollte der Foaferzähler gerade im Urlaub sein, springt ein freundlicher Kollege ein, der zu Protokoll gibt, er sei ja wieder zum Korken zurückgekehrt, weil sich Weine ,unter Schrauber einfach nicht so gut entwickeln‘. Kurzer Diskussionsstrang der Profis (und solcher, die sich dafür halten) unter sich. SO2-Spiegel dem Verschluss anpassen, Kohlensäure etc. pp – für mich heißt‘s hier immer Wecker stellen.
Dann kommt erneut ein Verbraucher und stellt die Frage, ob es denn überhaupt Erfahrungswerte mit Schraubern gebe, die zuverlässige Aussagen über das Reifeverhalten über Jahrzehnte…“PENFOLDS“ schreit die Gemeinde unisono. Das sollte mittlerweile jedes Kind wissen, dass dort noch Probeflaschen aus den 70ern auf die Verkostung warten, die mit Screwcap (jetzt wird‘s international) verschlossen sind. Aha, aber wie steht‘s mit Bordeaux? Ja, da wird jetzt auch schon verschraubt, meldet sich meist ein Händler zu Wort. Anschließend wieder ein Winzer: der bringt Egon Müller ins Spiel, denn es sei ja wohl vollkommen unvorstellbar, dass der seine TBAs verschraubt. Die Teilnehmer werden müde, man wird kompromissbereit, macht Vorschläge zur Güte: ,Wenn Du wirklich Pech mit dem Korken hast, dann bekommst Du die Flasche doch vom Händler oder Winzer ersetzt‘. Wenn noch Energie vorhanden ist, meldet sich einer der zahlreichen anwesenden Juristen und erklärt die mögliche Unwirksamkeit des Haftungsausschlusses bei Korkfehlern. Es folgt nur noch halbherzig ein verächtliches Schnauben, dass man ja wohl kaum nach 5 Jahren zum Händler zurückkehren könne oder dass der Winzer 600 Kilometer weit weg ist und es höchstens möglich wäre – da der Wein längst ausverkauft und der aktuelle Jahrgang viel teurer ist – die Rücküberweisung von 13 Euro zu verlangen, was irgendwie albern klänge. Das halten alle Parteien für ein würdiges Schlusswort.
Es ist alles gesagt, von allen!
Naja, fast alles: Ich bin ein Mann und als solcher für Technik zu begeistern – mehr noch als für Romantik. Und deswegen muss ich einmal widersprechen: ,Plopp‘ ist nett, irgendwie retro, aber das Öffnen eines Glasverschlusses: das ist High-Tech-Revolution. Meine erste mit Glasstopfen verschlossene Weinflasche war so aufregend wie mein erster Mietwagen mit schlüssellosem Zugangssystem. Faszinierend! Habe den ganzen Abend diese Flasche auf und zu gemacht. Ich glaube ganz fest, wenn man 1000 männlichen Verbrauchern – und das sind in Punkto Wein die Kaufentscheider – die Wahl zwischen Glasverschluss und Korken gibt um eine Dame zu beeindrucken, 983 werden den Glasverschluss wählen (und traurig sein, dass sich die Dame nicht stundenlang über dieses Hightech-Präzisionsinstrument unterhalten mag).
 Und einmal muss ich zustimmen. Ich habe noch nie bei einem Händler oder Winzer eine korkende Flasche reklamiert. Trotzdem habe ich mal eine ersetzt bekommen. Der Winzer hatte gelesen, dass ich seinen Wein aufgrund Korkfehlers nicht genießen konnte. Er hat mir einen neuen geschickt, was mich enorm gefreut hat – ich wusste von einer Probe, wie gut der ist. Am Wochenende habe ich ihn getrunken.
Und einmal muss ich zustimmen. Ich habe noch nie bei einem Händler oder Winzer eine korkende Flasche reklamiert. Trotzdem habe ich mal eine ersetzt bekommen. Der Winzer hatte gelesen, dass ich seinen Wein aufgrund Korkfehlers nicht genießen konnte. Er hat mir einen neuen geschickt, was mich enorm gefreut hat – ich wusste von einer Probe, wie gut der ist. Am Wochenende habe ich ihn getrunken.
Grenzhof Fiedler, Cabernet Sauvignon, 2003, Burgenland, Österreich. In der Nase fruchtig und süß mit typischer Johannisbeere, nur mäßigem Holz und einer leckeren Toffee-Note. Am Gaumen zeigt der Wein ganz feines Tannin, spürbare Mineralik und eine schöne Struktur: er ist körperreich aber nicht fett, fruchtig mit Johannis- aber vor allem Brombeere, dazu Kaffee, helle Schokolade und feines Holz. Mit und nach dem Essen wirkt er noch eine Spur süßer aber auch auf animierende Art adstringierend. Trotz des heißen Jahres kam der Wein mit nur 13,5 Prozent Alkohol in die Flasche, das unterstützt die Eleganz – ebenso wie der enorm lange Abgang.
Der Winzer erzählte mir beim Vinocamp, Cabernet sei seine Lieblingsrebsorte. Kann ich verstehen. Wenn ich solche Drogen anbauen würde, wäre ich auch gefährdet.